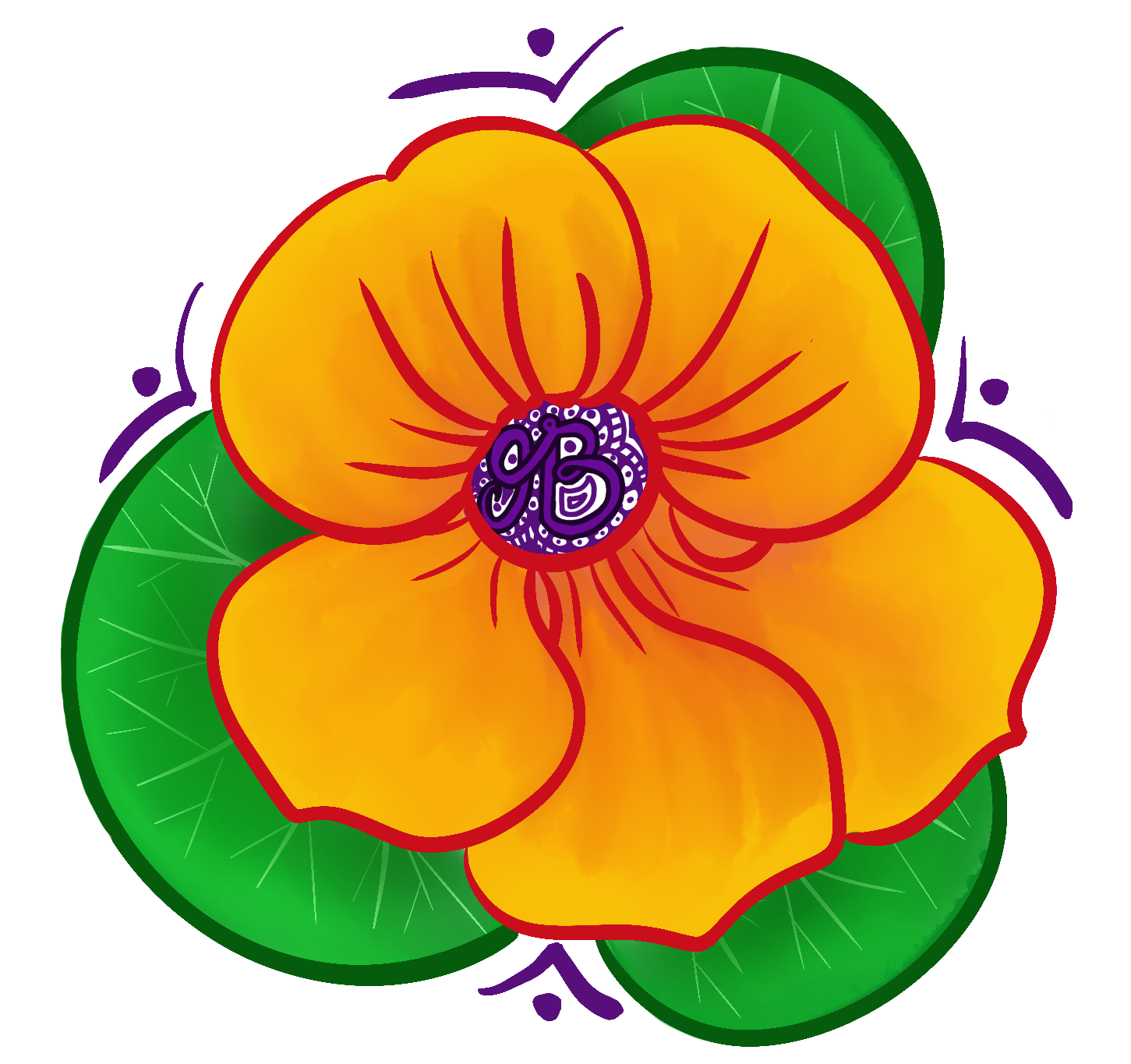Ein Schultag voller Gedanken zur Digitalisierung
Die Digitalisierung ist in den deutschen Schulen angekommen. Nicht sanft, nicht überlegt, sondern mit einem mächtigem Schock im März 2020. Plötzlich gab es keine Option mehr auszuweichen – und „wie in einem Brennglas“ zeigte sich eine schwierige Lage.
Die Probleme sind dabei sehr heterogen.
Zuerst denken die meisten dabei an die Probleme schwach ausgestatteter Schulen: keine (starke) Internetleitung, keine Geräte, kein Geld für Wartung und Support, wenig kompetente Lehrkräfte, Angst und Verweigerungshaltung. Es gibt aber auch sehr erfolgreiche Beispiele von Digitalisierung an Schulen – Leuchtturmschulen nennen wir sie. Dort gibt es teilweise eine gute Ausstattung, WLAN, Geräte, kompetente Lehrkräfte. Doch auch an diesen Schulen sind die Probleme nicht verschwunden, denn auch sie haben zu kämpfen: Mit den Fragen nach einer sinnvollen Didaktik, nach Datenschutz und Monopolmacht von einzelnen Konzernen, nach Support und Wartung, Fortbildung, nach Nachhaltigkeit. Ich arbeite an einer Schule, die sich irgendwo dazwischen befindet: Wir haben WLAN – für die Lehrkräfte. Wir haben Endgeräte, einige Konzepte, viele engagierte KollegInnen. Und damit stehen wir schon ziemlich gut da. Trotzdem möchte ich Sie auf einen fiktiven Schultag mitnehmen, in dem ich einige Schwachstellen des Systems aufzeigen und Anregungen geben möchte, wie wir in den Diskurs weiter einsteigen können.
Mein Arbeitstag beginnt um 7:50 im Lehrerzimmer. Das Lehrerzimmer ist speziell für die Oberstufe, wir haben zwei Standorte. Hier steht der Kopierer. Er ist nicht mehr so überlaufen wie früher – immer mehr LehrerInnen überlegen sich im Sinne der Nachhaltigkeit, ob das Arbeitsblatt wirklich 27 mal ausgedruckt werden muss oder ob man es nicht doch viel einfacher über die Lernplattform verteilen kann. Hätten alle SchülerInnen Zugang zum WLAN und eigene Endgeräte, wäre das ja auch gut machbar. Haben sie aber nicht. Und dafür gibt es gute Gründe, obwohl die technische Ausstattung, also Access Points, von unserem Schulträger in allen unterrichtlich genutzten Räumen an die Decke geschraubt wurden. Denn die Frage nach Verantwortlichkeiten sind so schwammig und ungeklärt, dass ein offenes WLAN der Schulleitung ein wenig wie Glücksspiel vorkommen muss: Was geschieht, wenn ein*e SchülerIn eine Straftat über das Schulnetz begeht, etwa eine Urheberrechtsverletzung? Wie geht man damit um, wenn Schülerinnen den Zugang zum WLAN nutzen, um Cybermobbing auszuüben?
Natürlich gibt es Antworten auf solche Fragen: Durch entsprechende Schutzmaßnahmen sollen Betreiber, also in diesem Fall die Schule oder der Schulträger, sicherstellen, dass Missbrauch und Straftaten erschwert werden. Dann haften nicht sie, sondern der durch Logfiles auffindbare Benutzer (z.B. hier sichtbar in einer Zusammenstellung für NRW) . Allerdings muss der WLAN-Betreiber dann auch sicherstellen können, dass die Logdaten sicher verwahrt werden. Und es muss geklärt sein, für welche Anfragen eine Einsicht legitim ist und für welche nicht. Diese Klärung steht in unserem Falle aus. Stattdessen heißt es: „Kann der Benutzer, der eine Urheberrechtsverletzung begangen hat, nicht nachvollzogen werden, haftet die Schulleitung.“ (PDF, S. 7) Ich kann es keiner Schulleitung übel nehmen, bei solchen Sätzen ein wenig Muffensausen zu haben. Und ich frage mich als Laie, wie dieser Satz mit den oben zitierten Ausführungen zur Störerhaftung konform geht. Ebenso ist die Frage ungeklärt, wo wir die Ressourcen hernehmen, um die SchülerInnen zu betreuen und zu schulen in Fragen der ethischen Medienkompetenz – Stichwort Cybermobbing. Wir sind in der glücklichen Lage, eine Schulpsychologin zu haben. Aber sie alleine kann den Bedarf an Betreuung, Beratung und Erziehung sicherlich nicht abdecken.
Also, es ist 7:50 und wir müssen reden, gesamtgesellschaftlich – über Verantwortung, klare Rechtslagen und ihre Umsetzung und einen besseren Betreuungsschlüssel an Schulen.
Mein Unterricht in meiner Pilotklasse beginnt um 8:00. Pilotklasse bedeutet: Die Lernenden bringen ihre eigenen Endgeräte mit (BYOD) und arbeiten vermehrt digital. Das birgt tolle Möglichkeiten, Unterricht weiter zu entwickeln. Mein Mathematikunterricht beginnt mit einer gemeinsamen Fragerunde und Kopfrechenübungen, dann zerstreuen die SchülerInnen sich in Lernteams, um an den Aufgaben in der Lernplattform zu arbeiten. Sie holen sich ihren Input über kuratierte Lernvideos, angereichert mit interaktiven Übungen, lösen Aufgaben dazu aus dem Lehrbuch oder solche, die ich mir speziell ausgedacht habe. Sie geben die Bearbeitungen online einzeln oder im Team ab. Ich laufe 60 Minuten von Tisch zu Tisch, wiederhole Input, stelle Fragen, motiviere, begleite. Nachmittags korrigiere ich die Abgaben. Mein Mann witzelt, ich sei zuerst mit dem Job und dann mit ihm verheiratet. Ich weiß: Wie mir geht es vielen KollegInnen. Klausuren, Konferenzen, Unterrichtszeit – da bleibt so wenig Raum für Individualisierung, für echte Menschlichkeit und echte Beratung. Ich bewundere stets die KollegInnen, die das anbieten können. Klar bieten die technischen Möglichkeiten eine tolle Unterstützung und auch Zeitersparnis, etwa über individuelle Lernpfade, Selbstkorrektur und direktes Feedback, aber sie bergen auch viel Arbeit: Das Material, an dem meine SchülerInnen an diesem fiktiven Tag arbeiten, habe ich in drei Jahren erstellt, immer wieder muss ich es überarbeiten und anpassen – entweder, weil die Software weiter entwickelt wird oder weil ich das Feedback aus dem Vorjahr einbaue oder weil ich es eben den aktuellen Gegebenheiten anpasse. Ich setze auf OER und teile mein Material, ich nutze auch Material von anderen. Dennoch: ein sich selbst korrigierender Mathematiktest, der mit Zufallsfragen auch Spicken erschwert, braucht einige Tage Arbeit, ehe er einsatzfähig ist. Und nicht alles kann ich von Maschinen korrigieren lassen: Ob eine Begründung sinnvoll geschrieben ist, ob ein Aufsatz in Deutsch gelungen ist, das entscheidet (noch) keine Maschine. Wollen wir, dass Maschinen so etwas jemals entscheiden können?
8:45, ich beobachte die Lerngruppe. An einem Tisch sitzen einige Mädchen um ihre Teamleitung herum, sie zeichnen am IPad und diskutieren eifrig. Neben ihnen sitzt eine Mitschülerin am Handy und schaut ein Video, während sie im Heft Notizen macht. Am Tisch hinter ihnen schaut mich ein Schüler verzweifelt an: Sein Laptop bezieht Windows-Updates, er kann ihn nicht nutzen. Ich weise ihn an, bei seinem Teamkollegen mit zu schauen und die Lösungen für die Fragen im Video später von zu Hause aus einzutragen. Die WLAN-Probleme des nächsten Schülers kann ich nicht lösen, er nutzt ein Macbook, da fehlt mir das technische Wissen. Um solchen Problemen auszuweichen, wird das BYOD-Konzept übrigens auch nicht auf andere Klassen ausgeweitet – statt dessen werden einheitlich Tablets angeschafft, ungeachtet der Eignung für einzelne Unterichtsszenarien und Anforderungen. Für unterschiedliche Gerätetypen fehlt schlicht das Personal, um es warten zu können. Das liegt auch daran, dass im Schul- und Behördenkontext oft IT-Gehälter gezahlt werden, die in der freien Wirtschaft eher mit einer Null mehr hinten dran ausgegeben werden. Hochqualifizierte, engagierte IT-Fachkräfte suchen sich daher in meiner Erfahrung selten Jobs in Schulen oder bei Schulträgern. Dabei wäre angesichts der sensiblen Datenlage und der großen Nutzungszahlen gerade dort das Know-How dringend gefragt. Da das Geld auch an der Schule selbst knapp ist, reicht es nicht für eine 1-zu-1 Ausstattung aller Räume. Also kann bei uns in Zukunft Unterricht mit Endgräten nur stattfinden, wenn der IPad-Koffer gerade nicht anders verbucht ist. Oder man sich eben in der Pilotklasse auf die technische Heterogenität einlässt. Ich lasse das technische Problem erstmal liegen – das Team hat Fragen zum Lernstoff, also diskutieren wir eine Weile und dann teilen sie sich auf, um jeder für sich mit Aufgaben aus dem Buch zu üben. Ich schaue noch kurz in den Nebenraum – dort hat sich eine Gruppe hin zurückgezogen, um Plakate für eine Aufgabe zu erstellen. Zwei Laptops stehen auf dem Tisch, das sind die Leihgeräte, die wir an die finanziell weniger starken SchülerInnen ausgeben. (Wie etwa auch die Computertruhe.) Die Laptops stammen von einer Firma, die sie aussortiert und gespendet hat, statt zu verschrotten. Natürlich sind sie einige Jahre alt, wir betreiben sie mit Linux Ubuntu, und die Erfahrungen sind sehr positiv – auch, weil engagierte Lehrkräfte und Ehepartner sich unentgeltlich um die Wartung kümmern. Die SchülerInnen nehmen sie meistens nicht mit nach Hause – zu schwer und auch ein bisschen uncool. Aber wir haben ein privilegiertes Einzugsgebiet: Zuhause hat fast jede/r einen Rechner und einen halbwegs stabilen Internetzugang. Bei mehr als 5 Videos wird es im Livestream wackelig bei einigen, wissen wir seit Corona. Aber das, was gerade in meinem Klassenraum passiert, können alle auch im Lockdown abrufen. Der technische Support fehlt ihnen dort aber immer noch. Firmen schicken ihre IT-Abteilung zu MitarbeiterInnen im Homeoffice, um VPN-Verbindungen einzurichten und Firmenhardware zu warten. Unsere Kinder lassen wir Internetzugang und technische Wartung alleine machen.
Es ist 9:00 und wir müssen reden – über Lehrerarbeitszeiten, wieder Betreuungsschlüssel, Lizenzen von Bildungsmaterial, der Frage nach KI im Schulwesen, über Ausstattung und Support und technische Unterstützung von sozial schwächeren Schüler*innen, über Geld im Bildungswesen und über die Verantwortung und Anteile, die Firmen hier haben und haben sollten.
Mein Tag geht weiter: 11:50, ich habe noch Informatikunterricht. Der Rahmenplan sieht vor, dass wir uns mit Datenbankzugriffen beschäftigen, die SchülerInnen sollen programmieren. Ich will mich an den Rahmenplan nicht halten. Denn ein Großteil der SchülerInnen hat keinerlei Vorerfahrung mit Programmierung, mit Informatik im Ganzen. Wir klären die Frage, ob es 1600 schon Handys gab und ob Frauen überhaupt jemals einen Computer angefasst haben, ehe der zweite Weltkrieg vorbei war. Wir diskutieren über Datenschutz und die Frage, welchen Messenger man am besten nehmen sollte. Warum ist Artikel 13 so wichtig, fragten meine Schüler*innen mich 2019, und was ist das mit Trump und seiner Wahl, war die wirklich manipuliert? Wir haben unseren schulinternen Lehrplan angepasst, geschoben und getauscht, bis es passte. Aber wir können mangels Informatikunterricht in der Mittelstufe in der Oberstufe nicht einen Lehrplan umsetzen, der so viel Grundwissen schon voraussetzt und der gleichzeitig auch keinen Raum lässt für die Fragen, die eigentlich wirklich relevant sind. Informatik ist mehr als Programmieren lernen. Und eigentlich müsste dieser Informatikunterricht, der, der die technischen Grundlagen mit den gesellschaftlichen Fragen verbindet, ein Pflichtbestandteil sein. Wie sollen wir erwarten, dass junge Erwachsene digital mündig werden, wenn wir ihnen nie die Zeit geben, sich die notwendigen Wissens- und Kompetenzgrundlagen zu erarbeiten?
Dazu passt auch die Wahl unserer Lernplattform: Während sich in der Oberstufe das OpenSource System Moodle etablierte, setzte einer unserer Mittelstufenstandorte auf eine deutsche Serverlösung, der andere auf ein Produkt eines amerikanischen Anbieters. Und wie in einer Nussschale bildet unser Lehrerzimmer nun die gesellschaftlichen Diskussionen zu Lernplattformen ab. Was ist erlaubt? Die Frage ist nicht so leicht zu beantworten – denn auf der einen Seite lehnen Datenschützer Lösungen, bei denen personenbezogene Daten von Schutzbefohlenen in das EU-Ausland transferiert werden, ab. Auf der anderen Seite setzt selbst die Behörde teilweise auf solche Lösungen. Also, es ist verboten das einzusetzen, aber machen kann man es trotzdem? Und die Frage, wie sicher die Daten in den Systemen sind, will ich eigentlich gar nicht so genau stellen: Ein Honeypot mit den Daten vieler Schulen bei einer deutschen Firma oder ein besser gesichertes, amerikanisches System mit lauter Hintertüren oder ein System auf dem eigenen Server, gewartet vom Mathekollegen in seiner Freizeit? Es scheint, die ideale Lösung fehlt hier, vielleicht auch wieder, weil das geschulte Personal fehlt. Was ist sinnvoll? Auch hier ist die Antwort nicht leicht – während ein System ein reines LMS, also Lehr-Lern-Management-System ist, ist das andere eher ein Content-Management-System und das dritte eine Groupware. Eigentlich vergleicht man also ständig Äpfel mit Birnen. Beide enthalten Zucker, aber sie schmecken sehr unterschiedlich. Manche KollegInnen sind so verunsichert, dass sie sich erbost wehren gegen die Zumutung, sich noch in ein weiteres System einarbeiten zu müssen. Auch hier merkt man: Die notwendigen Grundkompetenzen, die über eine „Knöpfchenkunde“ hinausgehen, fehlen nicht nur den SchülerInnen in meinem Informatikkurs, sondern auch den KollegInnen – wie sollten sie diese auch erworben haben? Niemand hat sie je zuvor dazu bewegt, sich mit digitalen Phänomenen, technischen Strukturen oder ähnlichem zu beschäftigen. Und ich möchte klarstellen, dass die betroffenen Lehrkräfte keinesfalls faul sind, wie das manchmal anklingt: Sie sind auf andere Sachen spezialisiert (ich möchte beispielsweise nicht näher zu Legasthenie befragt werden) und haben anderen, nicht weniger guten Unterricht gemacht. Sie sind ein Abbild der Gesellschaft, nicht eine Gruppe, die sich vor einer Verantwortung gedrückt hat, wie manche ihnen vorwerfen. Der Unterschied zwischen Suchzeile und Browsereingabezeile verschwindet in immer mehr Usability, ebenso wie die Notwendigkeit schwindet, IT-Systeme in ihrem Grundaufbau zu verstehen, um sie zu nutzen. Und je mehr das gesamtgesellschaftliche Verständnis dieser Strukturen schwindet, desto schwieriger wird es, in Schule eine umfassende digitale Mündigkeit mit dem dafür notwendigen technischen Grundwissen sowohl bei Lehrenden als auch bei Lernenden zu etablieren.
Einmal im Jahr gestalte ich eine Webinarreihe zum Thema Datenschutz. Auch hier setze ich am Anfang an: Wie ist das Internet aufgebaut? Welche Rechte gelten dort? Was ist der Unterschied zwischen technischer Datensicherheit und Legalität einer Handlung? Die KollegInnen sind meistens sehr dankbar, freuen sich – und sind immer wieder auch geschockt, entsetzt. Wenn Konzerne uns so ausspähen können, warum setzen wir diese Tools dann im Unterricht ein?“, fragte mich 2019 ein Kollege aus der Grundschule. „Gibt es keine Alternativen?“ Doch, denke ich, ziemlich oft gibt es die, aber die brauchen langfristige Finanzierung. Sie müssen geschult werden. Und, vor allem: Sie brauchen eine Lobby. Wer bezahlt Lobbyarbeit für OpenSource Lösungen, die den Datenschutz wahren? Eine Erfolgsgeschichte ist hier beispielsweise das in Hamburg nun flächendeckend eingekaufte Tool „Edkimo“, das von einem Berliner Entwicklerteam so datensparsam erschaffen wurde, dass für nicht registrierte Nutzer*innen nicht mal Serverlogs erfasst werden. Es geht also, und man muss nicht mal so viel Geld hinein versenken, wie das etwa bei Lösungen einiger Bundesländer geschehen ist. (Nun haben diese Lösungen zumeist allerdings auch einen weitaus größeren Funktionsumfang.) Man kann in Schule sinnvoll und wirksam OpenSource einsetzen – aber den Sinn dahinter, warum man überhaupt OpenSource nutzt statt der bequemen, vertrauten Konzernlösung, und die Nutzung verschiedener Tools und Umgebungen erschließt sich den Lehrkräften nicht von alleine. Was sich ihnen aber nicht erschließt, das zeigt meine Praxis, das können sie auch nicht vorleben.
Es ist 13:20 und wir müssen reden – über den Umgang unserer Gesellschaft und unserer Schule mit informatischen Grundkenntnissen, über die Abwägung zwischen Datenschutz und Bequemlichkeit und darüber, welche Werte wir in der Schule durch unser digitales Handeln und unsere Werkzeugauswahl vorleben können und wollen.
In der nächsten Stunde, 13:45, habe ich Deutsch. Die Klasse hat keine Endgeräte und kein WLAN. Im Klassenraum steht ein PC für die Lehrkraft, damit steuert man den Beamer an. Wir haben Beamersysteme und in manchen Räumen auch interaktive Tafeln, bei jeder Konferenz können wir uns wieder darüber Gedanken machen: Braucht eine Bildung von morgen wirklich eine zentrale, interaktive Tafel oder reicht ein Beamer? Ist Frontalunterricht effektiv, um Schüler*innen auf das vorzubereiten, was sie erwartet? Was erwartet uns? Klimakatastrophe, Rechtsruck, Unsicherheit, Überwachung? Oder doch mehr Partizipation durch freien Wissensaustausch, lebenslanges Lernen, Agilität? Es ist sicherlich unsere Verantwortung als Lehrkräfte, aber auch als Gesellschaft im Ganzen, über diese Fragen zu diskutieren. Denn die Digitalisierung der Gesellschaft macht mindestens seit März dieses Jahres auch vor dem Schulsystem nicht Halt – und wir prägen darin, was für eine Art von Gesellschaft wir uns wünschen. Was im kleinen in den Diskussionen auf den Konferenzen immer wieder sichtbar wird – Beamer versus interaktive Tafel, iPad versus Surface, Word versus LibreOffice – birgt im Hintergrund die große Frage nach unserer Zukunftsvision: Gemeinschaftlich, frei und mündig oder überwacht, zentralisiert und angepasst? Sicherlich liegt die Wahrheit hier, wie so oft, auch in der Mitte. Ich empfehle an dieser Stelle den Text des Arbeitsgruppe „Chaos macht Schule“ des Chaos Computer Clubs, in dem gemeinschaftliche Forderungen an die Digitalisierung von Schule gestellt werden. Wesentliche Pfeiler sind etwa die Forderung nach freier Software und reparierbarer Hardware, um Schüler*innen einen Rahmen zu geben, in dem sie frei von Markenprägung und Gewinninteressen ihre digitale Mündigkeit entwickeln können, ohne dabei den Aspekt von Nachhaltigkeit aus den Augen zu verlieren. Auch die von mir schon angesprochenen Aspekte von Finanzierung und Lehrerarbeitszeit werden hier sinnvoll eingegliedert. Wen die didaktischen Aspekte mehr interessieren, sei an den „Routenplaner Digitale Bildung“ oder zur kritischen Betrachtung an die größeren Frameworks wie „Die vier Dimensionen der Bildung“ oder Belshaws „Digital Literacy“ verwiesen.
Für mich macht die Digitalisierung eine kurze Pause, während ich ganz traditionell mit meinen Schüler*innen eine Lyrikanalyse diskutiere – und im Hinterkopf kurz bedauer, dass wir den Text mangels Endgräten nicht gemeinsam annotieren können. Mein Kollege, der mich hospitiert, bewundert in der Nachbesprechung diese Idee. Digital geht eben vieles, was analog nicht geht – aber wir unterrichten immer noch, als seien wir vor 50 oder 100 Jahren stehen geblieben. Das liegt auch daran, dass wir es ja gar nicht anders beigebracht bekommen. Ich bin froh, mein Netzwerk online zu haben, das mich inspiriert, und eine Schulleitung, die uns Zeit für kollegialen Austausch gibt, für Mini-Fortbildungen, aber dennoch: Uns fehlt massiv Zeit, selbst zu lernen. Wenn man derzeit manchen Diskussionen lauscht, ist Präsenzunterricht, bei dem alle an ihrem Platz sitzen, auch sowieso das einzige, was Bildung gewährleisten kann… Aber man kann sich dem Eindruck nicht erwehren, dass hier den Entscheidungsträgern und Diskutierenden die Fantasie fehlt, sich anderen Unterricht zu denken. Manche meiner Schüler*innen wünschen sich derzeit einen neuen Lockdown „damit sie endlich mal wieder in Ruhe lernen können“. Andere haben Angst davor, wieder in Chaos und mangelnder Routine zu versinken, ebenso wie den Kontakt zu ihren Peers zu verlieren. Schule ist eben mehr als Unterricht. Dennoch scheint es mir sinnvoll, die Chancen der Digitalisierung zu nutzen, um über unseren Unterricht als Konzept nachzudenken, statt die Strukturen, die dem Zeitalter der Industrialisierung angepasst sind, ungefragt weiter zu tradieren.
Es ist 15:30 und wir müssen reden – über zeitgemäße Bildung und die Welt, in der wir leben wollen, über nachhaltige Hard- und Software, digitale Mündigkeit und das Lernen unserer Lehrkräfte.
Am besten reden wir bald. Denn mein Arbeitstag endet (vorerst) um 16:45, ich muss meinen Sohn aus dem Kindergarten holen, aber die Entwicklung unserer Gesellschaft stoppt nicht, die Probleme hören nicht einfach auf, und eine bessere Zukunft, eine gute Digitalisierung der Schule, in der wir Teilhabe, Freiheit, Kreativität und tieferes Verständnis erleben können, kann noch von uns gestaltet werden. Mit ihr werden wir auch die Möglichkeit haben, unsere gesamte Gesellschaft zu gestalten. Ich freue mich auf euch im nächsten Gespräch, in einer Jitsi-Konferenz, einem Mumble-Talk oder ähnlichem…

„Wir müssen reden“ von MBraun ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz.