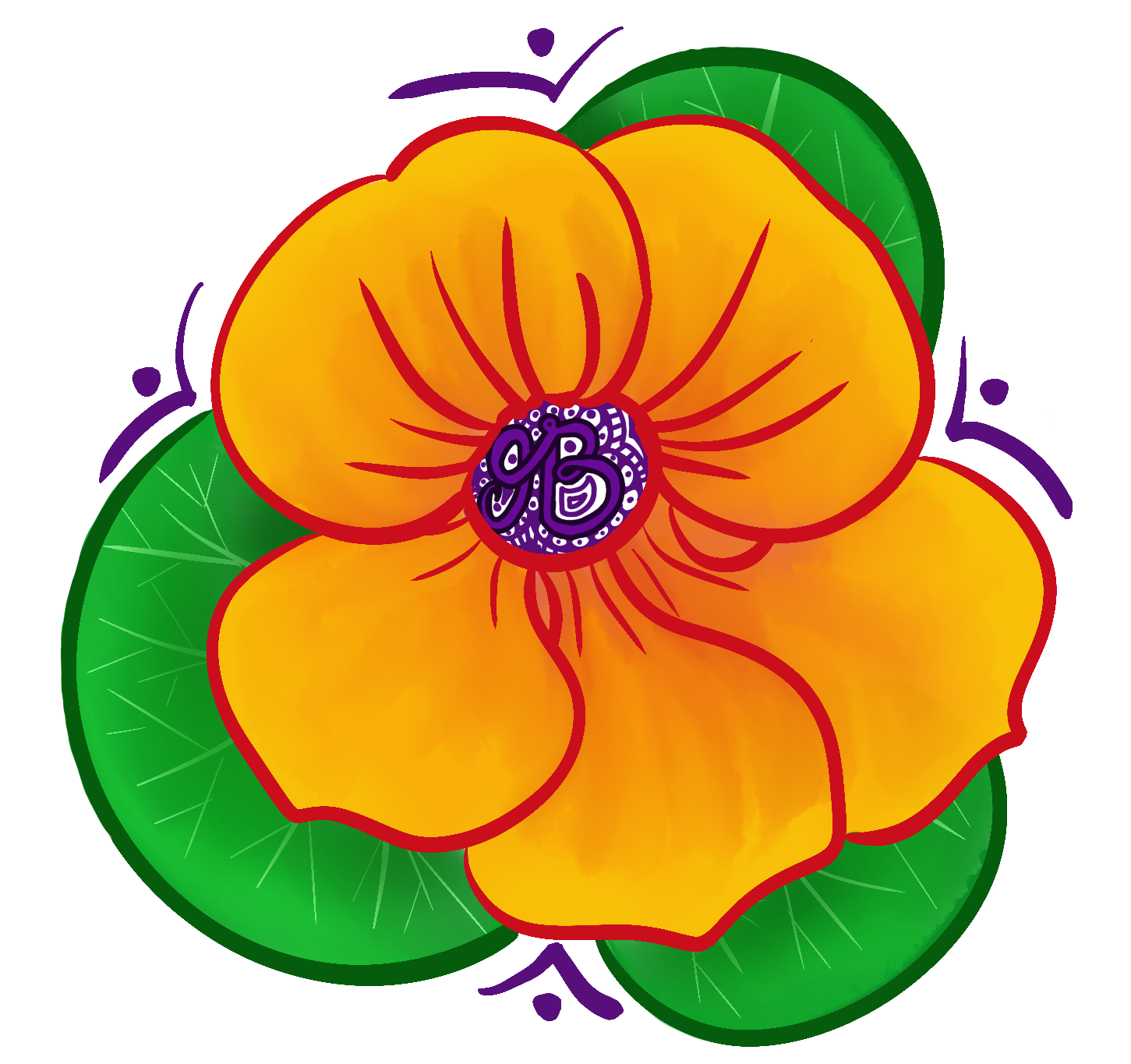Jeder Lehramtsstudent wird stets angehalten, die eigene Bildungsbiografie, das eigene Lernen und Leben kritisch zu beäugen, zu reflektieren. Portfolios, Tagebücher, Diskussionen mit dem Teddybär – alles ist möglich. Wichtig erscheint aber, in regelmäßigen Abständen inne zu halten, Luft zu holen, in sich zu kehren, um dann auskehren zu können mit den Gedanken und dem wirren Selbst. Ich denke nicht, dass diese Notwendigkeit mit dem Ende des Referendariats abstirbt. Ein Blog ist doch eigentlich ein Ort zu reflektieren? Ich ergänze hier einfach ein paar Gedanken. Ich lasse das Datum weg… mal sehen, wie sich die Biografie entwickelt, inhaltlich, nicht zeitlich gebunden.
1. Eintrag
Ich bin ein Akademikerkind. Das hat gewisse Vorteile, aber man kann es nicht ändern. Also hat es auch Nachteile. In meinem ganzen Leben wurde nie angezweifelt, dass ich auch Akademikerin werden würde. Bei meinem Bruder schon, aber das ist eine andere Geschichte, außerdem ist er es jetzt auch, also zählt das nicht. Ich machte Abi und studierte und jetzt bin ich Lehrerin. Mein Leben ist quasi Bildung. Das kann einem manchmal ganz schön auf den Wecker gehen. Vor allem, weil alle immer meinen, von meinem Leben eine Ahnung zu haben, bloß weil sie eine Ahnung haben, was Bildung ist. Oder sein sollte. Meistens ist ein Bildungsleben aber ganz nett. Ich frage mich nur – bleibt das so? Mir passieren so seltsame Dinge in diesem Bildungsleben, da fragt man sich sowas. Also, heute zum Beispiel. Ich unterrichte Oberstufe. Der winzig kleine Kurs arbeitet immer halbwegs gut mit, wenn sie nicht mitarbeiten, mache ich halt ein bisschen Einzeltheater an der Tafel und alle sind zufrieden. Also, Oberstufe. Das ist ja die Elite der Gesellschaft, zumindest so bildungsmäßig. Sozial sind die nicht immer Elite, das könnte man mal bedenken, aber nun, zumindest intelligent sollten sie sein, sie machen ja gerade Abitur. Lauter Intelligenzbestien da vor mir. Wir kaspern uns durch die Ableitungsregeln. Die Schüler nehmen sie mit Begeisterung auf. Die Taktik, erst etwas kompliziert zu erklären und dann einen einfacheren Weg zu zeigen, löst tiefgreifende emotionale Reaktionen aus, das sollte jeder mal probieren. Dann glauben die Schüler, das Neue sei so einfach, dass sie es – schwupps – gelernt haben. Sagen sie heute zumindest. Mal sehen, wie es nächste Stunde ist. Naja, ich habe auf jeden Fall Hausaufgaben verkündet. Die werden gerne gelassen. Intelligenzbestien. Mit Betonung auf Bestien, denke ich. Es ist 10 Minuten vor Schluss. Die Schüler packen. Ich gebe erstaunt zu bedenken, dass man die Hausaufgaben ja nun schon anfangen könne, noch sei ich ja da, um zu helfen. Verständnislos werde ich angeschaut – nein, das machen wir lieber zu Hause. Ich habe nichts dagegen, in Heimarbeit neuen Stoff vertiefend zu üben, aber ich frage mich: Die geistige Elite des Volkes. Ist es nicht irgendwie intelligenter, 10 Minuten in der Schule zu arbeiten, die man eh dort verbringen muss, als 20 Minuten der Freizeit am Nachmittag zu opfern? Denn schließlich ist die Freizeit ziemlich wichtig, so für so einen Bildungsbürger in der Oberstufe. Da kann man sich nämlich echt mal bilden, im humbolt’schen Sinne, Entfaltung der Persönlichkeit. Da sind keine Hindernisse, was man den so insgesamt können sollte, da kann man sich ganz ungehindert mal in was vertiefen – aber stattdessen wählen meine Intelligenzbestien die Ableitungen des nachmittags. Wer denkt darüber nach? Die Bestien offensichtlich nicht, die schafft 80 Minuten so sehr, da ist nichts mehr zum denken, scheinbar. Das ist so ein Bildungsleben, das ist irgendwie komisch, wenn man sich Fragen stellt, die keiner sonst zu bedenken scheint.Versteht mich nicht falsch, natürlich halte ich die Schule insgesamt und die Ableitungen im besonderen für eine ziemlich wichtige Sache. Ich glaube bloß, dass wir das große Glück haben, in einer Kultur zu leben, die diese wichtigen Allgemeinbildungsdinge und die Sache mit dem Wissen über die Welt in geordnete Institutionen gepackt hat. Nee, da ist nicht immer als gut in diesen Anstalten, aber die Idee an sich – eine Anstalt für Bildung – die ist ja schon mal ziemlich genial. Da kann man dann hingehen, und wenn man die Zeit anständig nutzt, dann hat man nebenher noch Zeit für die individuelle Bildung. Für’s persönliche Entfalten. Das macht meistens eh mehr Spaß. Man muss nur aufpassen, dass man niemandem auf die Füße tritt. Aber wie das geht, dass sollte man als Bildungswesen ja mal lernen, das lernt man nämlich überall, wo viele auf einem Haufen sein wollen. Ich habe bloß das Gefühl, diese institutionell verordnete Zeit, die wird nicht ganz optimal genutzt. Also, erstens, vom Lehrer. Der muss und macht ganz vieles, was irgendwie gar nicht mit dem Ziel der Anstalt zusammenhängt. Oder doch? Was ist eigentlich das Ziel von Schule? Und dann die Schüler. Die machen alles mögliche – aber selten so richtig effektiv lernen. Halt lieber packen als rechnen. Tasche packen gehört meiner Meinung nach nicht zu den Kompetenzen, die in der Oberstufe vermittelt werden müssen. Über die letzte Party zu reden, auch nicht. Oder doch? Abbau von Alkohol im Blut, das ist ein wichtiges exponentielles Modell. Und soziale Netze sind sicherlich ein interessantes Phänomen, das kann man auch mal untersuchen – bilden sich da Muster? Nach welchem Schema? In der Krimiserie Numbers geht das, geht das auch in der Oberstufe? Das sind schon wieder so Fragen, die stellen sich meine Intelligenzbestien irgendwie nicht. Warum nicht? Ein Bildungsleben – ist das nicht immer Fragen zu stellen? Ich stelle Fragen. Ich glaube nicht, dass es Antworten gibt. Ich schau mir das mal morgen wieder an. Vielleicht weiß man ja am Ende eine Antwort.
2. Eintrag
Ich habe festgestellt, man weiß auch übermorgen keine Antwort darauf. Also habe ich – bin ja immer neugierig – die liebenswerten Bestien einfach selber gefragt. Erstens wurde festgehalten, dass es in der Schule zu laut sei zum Arbeiten. Jawohl. Meine schmerzenden Stimmbänder und ich stimmen vorbehaltlos zu. Konsequent folgernd schlage ich vor, das doch zu ändern – schließlich kommt der Lärm ja nicht aus der Wand. Nein, korrigiert mich die Elite des Volkes, das ist unnütz. Arbeiten würde man eh nicht. Warum? Ja, wird mir erläutert, das ist so: Wenn man in der Schule eine Aufgabe beginnt, dann wird man ja vermutlich nicht fertig. Man muss also eventuell am Ende der 10 Minuten einen Gedanken abbrechen, den man gerade gefasst hat. Bis man dann zu Hause wieder am Schreibtisch sitzt, ist dieser Gedanke vielleicht verloren. Der Verlust dieses wertvollen Gutes ist aber nicht zu riskieren. Also denkt man lieber gar nicht, dann kann man keinen Gedanken verlieren. Dieselbe Argumentation gilt natürlich auch für 20 oder 30 minütige Arbeitsphasen.Die Logik der Ausführungen ist bestechend. Ich frage mich, wie ich es eigentlich bei einem Großteil meiner Unterrichtsstunden schaffe, etwa nach 90 Minuten alle relevanten Gedanken ans Volk gebracht zu haben. Zu allem Überfluss merke ich mir auch noch, wo ich beim nächsten Mal wieder ansetzen kann! Gut, da muss ich aber fairerweise zugeben: Das merke ich mir nur, weil ich mir Notizen mache. Wenn ich die mal vergesse, muss ich immer die Schüler fragen. Die merken’s dann auch, dass ich’s vergessen habe, und sagen: „Das haben wir vergessen! Am besten erklären Sie es nochmal neu!“ – Da merkt man es dann eben doch: Schlau sind sie, diese Bestien. Keine Chance wird vertan, alle Lücken genutzt. Nur die Lücken in der Mauer des Gehirns, die zulassen würden, dass man sich den Satz des Pythagoras mal merken würde, statt ihn stets durch den Kopf hindurch fliegen zu lassen, die haben wir bis jetzt noch nicht gefunden. Ich denke, dass ist vermutlich eine längerfristige Aufgabe. Wobei – habe ich mich doch oben über die mangelnden Fragen echauffiert? Auch nicht richtig! Natürlich fragen die künftigen Manager, Ingenieure und leitenden Angestellten, ja, sie hinterfragen sogar. Nicht den Sinn des Lebens – zumindest nicht in meiner Gegenwart – aber doch zumindest den Sinn darin, den Satz des Pythagoras zu lernen. Das ist ja aus Sicht der Aufklärung eine ziemlich gute Frage. Eine Antwort darauf ist auch nicht so einfach. Denn wenn wir ehrlich sind – außerhalb der Schule braucht den Satz so ganz konkret kaum einer. Und dass es ein paar Aufgaben mit Leitern gibt, in denen man ihn benutzen kann, macht ihn auch nicht zu einem wahnsinnig relevanten Stoff innerhalb der Lebenswelt der Schüler. Dass er als Grundlage und Beispiel für mathematisches Denken herhält, als didaktisch reduzierter Vorstoß in die Welt der unendlich hübschen Beweise, als taugliches Werkzeug des Ackerns an schulisch-institutionell reduzierten Aufgaben, das erscheint mir reichlich abstrakt. Wie soll ich das vermitteln? Dass das Denken sich nur lernt, wenn man denkt, das ist logisch, aber doch keinesfalls nachvollziehbar – höchstens in der Retrospektive, aber die kann logischerweise kein Schüler, kein Lernender überhaupt einnehmen. Ein Paradoxon, dass die mathematische Bildung, ja vermutlich die ganze Bildung begleitet. Faszinierend, irritierend, manchmal frustrierend. Ich denke, ich werde dieses schillernde Gebilde noch eine Weile beobachten.
3. Eintrag
Wenn man sechs Stunden lang Zeit hat, dann kann man als Lehrer davon eine mit kopieren, eine mit Herumrennen und 4 mit Lehren, Beraten und Ermahnen verbringen. Meine Bestien aber sind so unendlich kreativer! Sie können – so meine Beobachtung – arbeiten (sic!), tratschen, flirten, chatten, Musik hören, Chaos verbreiten, Putzpläne überarbeiten, Theater abhalten, essen, trinken, spielen, shoppen, lesen, diskutieren, über den Sinn des Lebens debattieren, quengeln, lärmen, fummeln, Papier zerreißen… jetzt weiß ich auf jeden Fall, warum die Übersichten von Hilbert Meyer immer so unübersichtlich waren. Unterricht grafisch darzustellen, der insbesondere noch Anteile von Schüler-Arbeitsphasen beinhaltet, ist einfach eine ziemlich chaotische Idee. Im Feedback dieses Arbeitstages haben sich meine Lieblinge allesamt positiv geäußert, allerdings, man siehe den vorherigen Eintrag, paradox. Fasst man die Rückmeldungen nämlich zusammen, so wünschen sie sich mehr Frontalunterricht und mehr Erklärungen an der Tafel in Kombination mit Gruppenarbeit und freier Zeiteinteilung sowie ausreichend Zeit, den Stoff durchzuarbeiten. Sie wünschen sich Übungsmaterial mit vielen verschiedenen Beispielen, das nicht zu schwer ist und möglichst wenig Aufgaben beinhaltet. Sie wünschen sich stille Arbeitsphasen mit zahlreichen Abwechslungen und guten Lernteams, bei denen möglichst jeder sich gut konzentrieren kann und beschweren sich über den Lärm, der aufkommt, wenn ich den Raum verlasse. ALLE wünschen sich Ruhe, um konzentriert arbeiten zu können und ALLE beklagen sich über den Lärm. Ich fühle mich wie ein Seiltänzer über einem Abgrund voller Krokodile. Was soll ich tun? Frontale Erklärungen, danach Partner- oder Gruppenarbeit in einzelnen Räumen, so dass die Gespräche einer Gruppe nicht die Nachbargruppe stören? Abschließbare Kabinen für diejenigen, die zu ablenkungssensibel sind? Variantenreiche, gute Beispiele in wenigen, niveauvoll passenden Aufgaben für alle – Differenzierungsmaterial ist schließlich Material, und davon darf es ja nicht zu viel geben? Ohje, ja. Das erinnert mich daran, warum man unseren Beruf eine Profession nennt. Unplanbare, komplexe Situationen in Auseinandersetzung mit Klienten und wissenschaftlichen Paradoxien, gebunden von behördlichen Vorgaben. Dass ich niemals alle diese – wohlgemerkt, an sich sinnvollen – Wünsche erfüllen kann, ist offentsichtlich. Dass ich dennoch mich um bestmöglichen Unterricht bemühen will, ist zumindest auch mir klar. Nur wie, das ist nach all dem Studium und all der Forschung weder mir noch den leitenden Wissenschaftlern der empirischen Erziehungswissenschaft deutlich geworden – das ist eben das paradoxe, dass mich durch diesen Alltag begleitet, das diesen Blog befüllt – paradox ist ja bekanntlich nah an grotesk, was uns wiederum zur Satire wird, Realsatire, um den Alltag zu überleben, lachen wir drüber.Reflexiv gesehen ist es wenigstens beruhigend, dass meine kleinen Bestien in all diesem WirrWarr die Zeit für die wichtigen Dinge des Lebens zumindest teilweise bewahren: Wenn ich eine erbitterte Diskussion über die Deutung einer Bibelpassage im interreligiösen Diskurs angetragen bekomme, wenn mich Schüler des Nächtens anschreiben, um sich über Mathematik zu amüsieren, wenn die Fragen mal wieder die Stunde und den Schulstoff sprengen, dann denke ich: Ganz verloren ist die Welt noch nicht. Vielleicht – es ist Advent – vielleicht ist da ein kleines Licht. Vielleicht kann ich in all dem Chaos ein bißchen mehr Licht hineinmogeln, eine Kleinigkeit nur bewegen, das wäre schön. In dieser Hoffnung ist es eigentlich auch egal, wie ich meinen Unterricht plane – erstens passiert eh immer was anderes, als man gedacht hat, und zweitens ist es ja doch wichtiger, überhaupt etwas zu bewegen, als die Frage, wie genau man nun eine Exponentialgleichung löst, in 27 Schülerhirnen felsenfest zu verankern. Und egal, ob ich nun Gruppenarbeit, stille Phasen, viel oder wenig Aufgaben, Frontalunterricht oder Lehrvideos nutze – irgendwie erreiche ich irgendwen nicht. Im Ausgleich werde ich ja auch irgendwen mit dem gewählten Weg erreichen, alles andere wäre ganz gemeines Karma, und da glaube ich nicht dran.
4. Eintrag
Es ist viel Zeit ins Land gegangen. Meine Bestien von damals sind durchs Abitur, die meisten waren auch erfolgreich. Mir fällt auf, dass ich sie vermisse. Also, nicht so direkt genau diese Schüler, aber die Schülerinnen und Schüler „meiner“ Klasse, die, zu denen ich eben diese besondere Beziehung aufbauen durfte, die meine Schützlinge waren und bei denen ich mehr wusste als die Mathenote. Ich vermisse überhaupt nicht: Zeugniskonferenzen vorbereiten, Elterntelefonate führen, hinter Unterlagen hinterher laufen, Klassenfahrten planen und Sozialpädogogen mit Arbeit zuschachern.
Ich vermisse bei mir selber: Mit Begeisterung stundenlang Unterricht vorbereiten, der gelingt. Ruhe und Souveränität. Spaß am Engagement.
Moment.
Warum vermisse ich das? Was ist passiert?
Nun, zum einen bin ich Mutter geworden – das ist an sich ganz toll, schränkt aber die Zeit ein. Zum anderen aber spüre ich auch, dass Engagement sich nicht immer lohnt. Eigentlich lohnt es sich sogar sehr selten. Die Schüler können kaum besser Mathe. Die Eltern werden nicht netter, dankbarer oder auch nur höflicher. Die Schulleitung vergibt nicht mehr Lob. (Also, nicht mehr als eh schon.) Und jeder Fehler, den man macht, wiegt schwerer als die Mühe zuvor. Wie machen andere das, sich die Freude zu erhalten an diesem Beruf, über Jahre hinweg? Ich glaube, ich muss twittern. Oder noch etwas mehr unterrichten und mich selber beobachten dabei. Was macht Freude? Die Bindung? Der Erfolg? Die Sinnhaftigkeit?
5. Eintrag
Was macht Freude? Ich beobachte mich grundlegend selber und stelle fest: Es hat mir Spaß gemacht, diesen Blog zu überarbeiten und auf Lecks und Datenschutzprobleme zu testen. Ich habe dabei selber etwas gelernt und etwas (aus meiner Sicht) sinnvolles geschaffen. Also macht mir das Freude: Sinnhaftigkeit und Lernfortschritt. Ich wage mich ganz weit aus dem Fenster zu lehnen: Das ist bei den meisten Menschen so. Wir mögen Fortschritt, Erfolg und Sinnhaftigkeit. Das gilt ja auch für meine Lieblingsbestien. In der zehnten Klasse erfüllt es 17 Leute mit raschem Eifer, wenn man erwähnt, dass ein Stoff in der Abschlussprüfung drankommt – der Abschluss ist nämlich nah und das Lernen dafür für die meisten im Kurs sehr sinnvoll. In der siebten Klasse kann eine ganze Gruppe Jungs plötzlich das Ärgern einstellen, weil man ihnen den Sinn von „Freiheiten geben“ erläutert. (Ja, ehe sich Widerspruch regt: Eine Gruppe, nicht alle Jungs der Klasse!) Und in allen Klassen führt Erfolg, sofern er auf eine Phase des Herumknobelns und Arbeitens folgt, zu Jubelgeschrei und oft auch zu freudigem Weiter-Arbeiten. („Wie, schon Pause? Ich will jetzt aber nicht Pause machen, ich will Mathe machen!“ – Erwähnte ich schon, dass ich meine Klasse 10 unglaublich toll finde?)
Wie generiere ich das Gefühl von Sinnhaftigkeit häufiger in meinem Unterricht? Und wie gelingt es mir, mir selbst ein Gefühl von Sinnhaftigkeit zu ermöglichen?
Einen meiner Oberstufenkurse habe ich geteilt. Ein Teil der Schüler arbeitet auf einem Moodle, der Rest bekommt klassischen Präsenzunterricht. So kann jeder die Lernform wählen, die ihm liegt. Das macht für mich Sinn. Den Mehraufwand dafür kann ich daher leichter verkraften – Freude lässt besser arbeiten.
Einen gewissen Prozentsatz meiner Arbeitszeit reserviere ich mir für Fortbildungen und „digitalen Rumspielen“ – das macht Spaß, ermöglicht lernen und vernetzen. Und damit generiert es auch Sinn.
Funktioniert einigermaßen, mit dem Sinn für mich. (Fairerweise bin ich grad eine Woche mit krankem Fuß zuhause. Da hat man auch Zeit zu Sinn-Suchen und Verordnungen lesen.)
Wie ist es mit dem Sinn für die Schüler? Es gibt so viele Theorien, aber ich weiß, ich werde sie einfach fragen. Nach dem Abi, wenn sie wirklich offen antworten können. Oder die Kleinen, die sind meistens noch so erfrischend ehrlich. Hmm … Schülerfeedback wäre wohl mal wieder an der Reihe. Und ich fühle, da liegt kein Frühling, aber immerhin Motivation in der Luft.