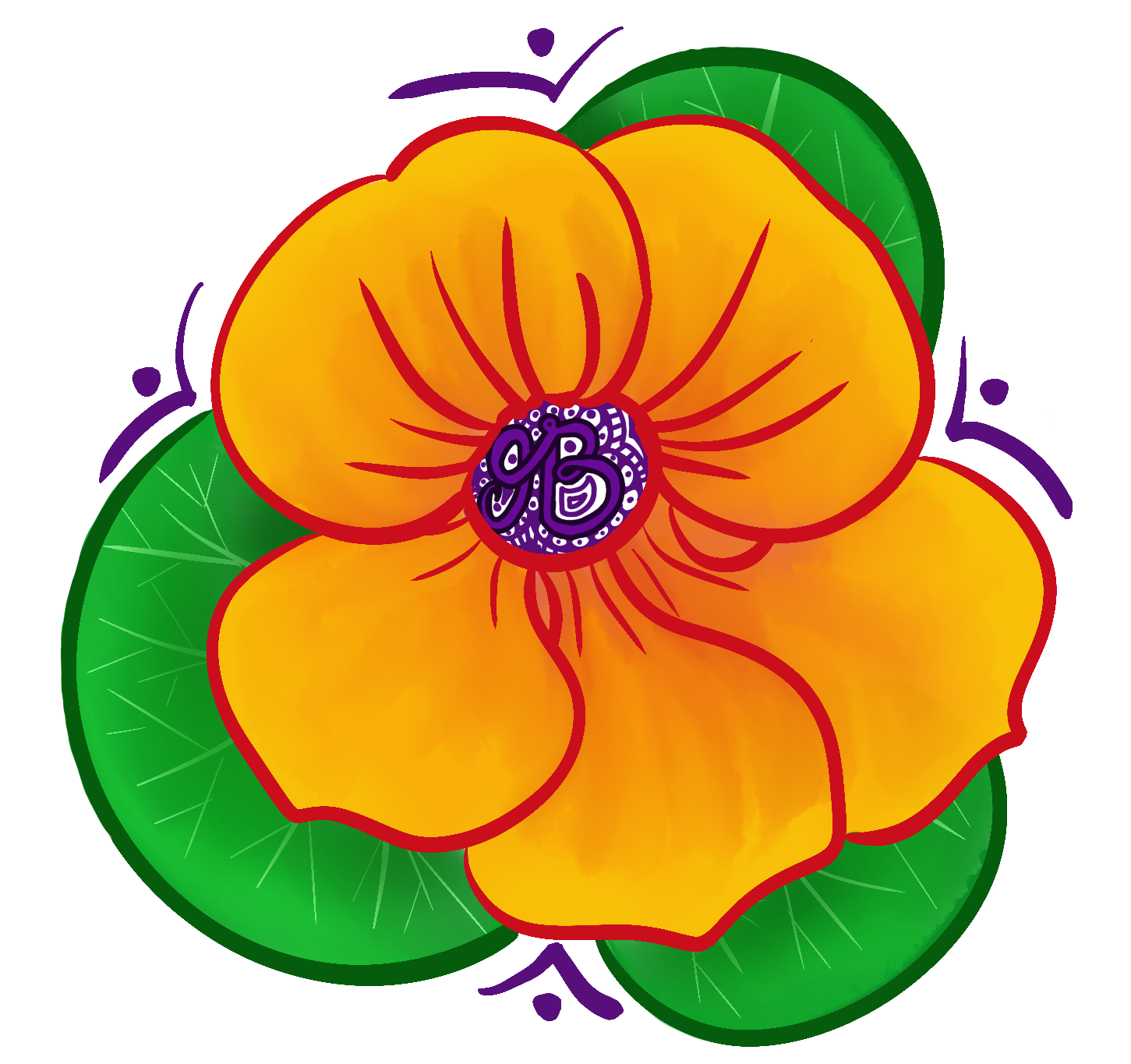Vom 4.5.2017 bis 6.5.2017 findet in Berlin, im Haus der Kulturen der Welt, die Auftaktkonferenz „Schools of tomorrow“ statt, zu der ich dank des Projekts Chaos macht Schule und meiner Schulleitung fahren durfte.
Um das, was ich erlebt habe, auch anderen zugänglich zu machen, dokumentiere ich die Reise hier. Die Inhalte der Vorträge stammen nicht von mir, sondern dem jeweiligen Vortragenden. Ich habe mich aber aus Gründen der besseren Lesbarkeit dafür entschieden, den Konjunktiv, indirekte Rede und andere sprachliche Konstrukte zur Kennzeichnung von Wiedergabe der Informationen weitestgehend nicht zu nutzen. Der geneigte Leser mag sich bei der Lektüre daran erinnern.
4.5. 2017
Um 15:38 fährt der ICE ab Hamburg Hauptbahnhof. Dank des zähen Verkehrs hätte ich ihn beinahe verpasst und habe das Gefühl, in ein chaotisches Wochenende zu starten. Das Gefühl bestätigt sich bei meiner Ankunft: Berlin ist in grauem Nieselregen verhangen und da ich in den letzten Tagen meine Mails nicht gecheckt habe, ist mir entgangen, dass ich keine Workshopsplätze für Freitag bekommen habe. Ich werde also nur an den Vorträgen und Diskussionen teilnehmen können. Ein bisschen bin ich traurig, aber dennoch froh, hier zu sein. Im Foyer sind Trennwände aus Tafeln und Stühlen zu künstlerischen Objekten geworden und eine Theatergruppe performt philosophische Theorien von Nietsche und anderen. Es fühlt sich anders an, raus aus dem Trott des Alltags, den Kopf frei machen für Kunst, Reflexion, Gesellschaftskritik. Sonntag werde ich wählen gehen in Schleswig-Holstein, wo ich wohne. Es fühlt sich passend an.
Der Direktor des HKW, Bernd Scherer, und die Initiatorin der Konferenz, Silvia Schermann, heißen im Auditorium die Anwesenden willkommen. Es ist eine internationale Konferenz, mit Simultanübersetzungen in Deutsch und Englisch, und ich höre um mich tatsächlich viele verschiedene europäische Sprachen. Da sind Menschen von Barcelona bis Helsinki, stelle ich später fest. Mein Protokoll wird eine bunte Mischung aus Deutsch und Englisch, aber ich brauche keine Übersetzung, Schulenglisch genügt. (Danke an meine alten Lehrer!)
Schule prägt Gesellschaft und Gesellschaft prägt Schule. Das ist nichts neues, aber ein Grund, inne zu halten und sich zu fragen: Welche Schule wollen wir? Denn die Antwort auf diese Frage ist nicht nur beschreibend, gesellschaftliche Strukturen aufgreifend, sondern auch normativ: Welche Gesellschaft wollen wir formen?
Wir stehen derzeit vor zahlreichen Herausforderung: Schule muss „Lernen lernen“ ermöglichen und dabei so attraktiv sein, dass der Besuch der Schule von Schülern und Eltern unterstützt wird. Sie muss Orientierungswissen vermitteln, die Schüler befähigen, mit der enormen Komplexität der modernen Welt umgehen zu können. Diese Gedanken sind nicht neu, bereits 1915 beschrieb John Dewley in dem Buch „Schools of To-morrow“ ähnliche Herausforderungen. Die Schule kann und sollte als ein „Labor der Demokratie“ betrachtet werden. Wie kann man Wissen demokratisieren? Wie entsteht relevantes Wissen in einer Gemeinschaft? Wie geht man mit Unwissen um? Mit Ungewissheit? Die These, Schule müsse das Spannungsfeld zwischen „Individualisierung“ und „Gemeinsinn“ schließen, ist dabei vielleicht zu überwinden: Wenn Schule Demokratie vorlebt, kann gerade die individuelle Entfaltung zur Entwicklung der Gemeinschaft beitragen.
Die zweite Sprecherin ist Sharon Doduan Otoo, eine Mutter undAutorin aus Großbritannien, die die immer noch problematische Diskrimnierung von Schwarzen an deutschen Schulen anspricht. Ihre vier Söhnr besuchen deutsche Schulen oder Kindergärten. Sie macht darauf aufmerksam, dass wir in einer westlich-deutschen Leitkultur leben, die sich sowohl im Material (Schulbücher, Lehrermaterial) als auch im Verhalten der Lehrkräfte und Erzieher niederschlägt. Die kulturellen Wurzeln von (farbigen) Immigranten werden selten bis gar nicht thematisiert, was die Identitätsbildung dieser jungen Menschen erschwert und sie in ihrer Entwicklung benachteilig. Was mich besonders überrascht, ist die Tatsache, dass die Benachteilung afrikanischer Immigranten wohl auch in den PISA-Ergebnissen zu sehen ist. (Oder sprach sie da von Immigranten im allgemeinen?) Ich wusste nicht, dass die Herkunft der Familie bei PISA mit erfasst wurde. (Aber wenn man so darüber nachdenkt, sie haben ja auch das Milieu und den Bildungsgrad der Eltern erfasst…) Ich frage mich, ob all die Formulierungen von „black power“ und „black pride“ wirklich nötig sind. Trennt man sich damit nicht irgendwie selbst ab? Ist das notwendig zur Identitätsbildung? Ist es nicht relevanter, welche Musik man mag, welche Politik man will, was für ein Mensch man ist? Sollte das nicht wichtiger sein? Offenbar ist Herkunft, Vergangenheit, Familie, Heimat für Menschen unglaublich relevant, es trennt und verbindet Einzelne. Der Vortrag macht mich nachdenklich und erinnert mich an diese Phänomene. Außerdem erinnert er mich daran, dass Sprache ein mächtiges Instrument ist, mit der wir unsere Umwelt formen, die auch Diskrimnierungen ermöglichen kann, die einem priviligierten weißen Umfeld oftmals entgehen. (Als Literaturwissenschaftlerin interessiert mich besonders die Erwähnung des Streites un die Bücher von Astrid Lindgren, in denen sich zahlreiche kolonial-rassistische Formulierungen finden. Allerdings wird das im Vortrag nur am Rande erwähnt, ausführlich gab es dazu erst vor kurzem einen Beitrag in „Praxis Deutsch“.)
Die Initatoren haben als nächstes auch Schülerinnen und Schüler eingeladen, von verschiedenen Schulen, aus den Projekten „Neue Expert*innen!“ und „Jugend hackt“. Sie tragen, moderiert von Markus Richter, verschiedene Wünsche und Ideen für eine zukünftige Schule vor, die sie in einem Workshop erarbeitet haben.
- Der Religionsunterricht sollte abgeschafft und durch flächendeckenden Ethik-Unterricht ersetzt werden, um der Vielfalt und der notwendigen Toleranz gerecht zu werden.
- Der Geschichtsunterricht sollte seine Konzentration aus westlich-deutsche Geschichte aufgeben, um den Eindruck, alles wichtige der Welt sei in Europa passiert, zu überwinden. Es sollte nicht nur auf die Geschichte der Mehrheit fokussiert werden. (Makaber: „Juden tauchen im Geschichtsunterricht immer nur dann auf, wenn sie getötet werden.“)
- Das Essen in der Mensa sollte die Vielfalt der Kulturen aufgreifen und halal/koschere Varianten beinhalten.
- In den Themenfeldern, die mit Individualisierung und Andersartigkeit zu tun haben (Sexualität, Behinderung, Religion…) fehlen Informationen. Es müssten diese Themen in allen Unterrichtsfächern und für alle Schüler verankert werden. Toleranz kann man nicht erzwingen, aber beibringen. (Ich liebe diesen Spruch!)
- Der Unterricht sollte später beginnen und ein klares Ende haben, so dass planbare Zeit für Freizeit, Ausgleich und individuelle Entfaltung bleibt. (Viele Anwesende im Raum unterstützen die Idee des späteren Beginns, auch Studien untermauern dies. Ich denke auch, dass es meine Arbeitsfähigkeit verbessern würde und bin total für ein festes Ende der Arbeitszeit auch für Lehrer.)
- An den Ganztagsschulen sollten Hausaufgaben abgeschafft werden. (Ich fühle mich an Jugend debattiert erinnert und frage mich, warum die eigentlich nicht hier sind. Ich frage mich auch, ob diese Forderung nicht aus einer recht priviligierten Perspektive gestellt wird: Die Hausaufgaben seien nur eine Wiederholung dessen, was im Unterricht behandelt wird. Ich denke: Sie sind die notwendige Übung, die im Unterricht aufgrund der Disziplinprobleme nicht durchgeführt werden können, die aufgrund von Zeitknappheit und Stofffülle nicht mehr „passen“ in das Konzept… auf Übungszeit zu verzichten klappt doch nicht, wenn man nicht eine schnelle Auffassunggabe hat.)
- Die Digitalisierung muss in der Schule ankommen: durch Ausstattung, Programmieren als Fach, Praxisbezug und ein Grundwissen über Technik bei allen Beteiligten.
- Es sollte öfter Projektunterricht und Praxisbezug geben, beispielsweise durch Kontakte in Betriebe. (Da schrillt bei mir eine kleine neoliberale Alarmglocke. Bildung nur um hinterher einen Beruf ergreifen zu können?)
- Der musische Bereich sollte flexibler gestaltet werden, so dass man sich früher vertiefen kann, aber auch mit alle musischen Bereichen regelmäßig in Kontakt kommt.
Die letzte Sprecherin ist Keri Facer, Professorin der Universität von Bristol.
Sie spricht über die Zukunft, das Morgen.
Es gibt viele mögliche Zukunften, viele Arten von „Morgen“. Es ist kennzeichnend für unsereZeit, dass wir nicht vorhersagen können, welche Realität werden wird. Unser Leben ist geprägt von Komplexität, Instabilität und Ungewissheit. Wichtige Herausforderungen, die unsere Gegenwart und Zukunft prägen, sind beispielsweise der demographische Wandel (Wenn Menschen 200,300 Jahre alt werden,wiesieht „long-life-learning“ dann aus?) und der Klimawandel. Die Schere zwischen arm und reich öffnet sich derzeit immer weiter und birgt somit enormes Konfliktpotential, die gesamte politische Situation wirkt eher instabil: Gewalt, Nationalismus und die Gefahr globaler Kriege scheint zuzunehmen. Der technologische Wandel, der teilweise eine Antwort darauf sein könnte, überrollt uns gleichzeitig mit zahlreichen weiteren, gravierenden Veränderungen: Big Data, quantified self, nicht-menschliche Technologien, die plötzlich unser Leben mitbestimmen und uns vor Fragen stellen, was Leben,was Menschsein eigentlich ist. Als Folge davon entsteht eine neue Art von Heterogenität: Nicht nur Religion, Herkunft, Sprache und Lernfähigkeit differenzieren, sondern auch Einstellung, Vorwissen und Zugang zu Technologie. Keri Facer betont aber auch, dass wir auf all diese Instabilitäten reagieren und sie ändern können. Schule habe in diesemKontext zwei wichtige Rollen.
- Alle Wege für die verschiedenen, nicht antizipierbaren Zukunft offen zu halten
- Die Zukunft aktiv zum Besseren zu beeinflussen, Labore für Demokratie und Gesellschaft zu sein
Sie erläutert, welche drei Schritte sie dafür für nötig hält.
Create the capacity to play with chance and time
Die meisten Menschen denken sich die Verknüpfung zwischen gestern, heute und morgen als Linie, entwerder von links nach rechts oder dabei ansteigend, also als ein nicht reversibler, stets voranschreitender Prozess. Problematisch an dieser Vorstellung ist die Art, wie man Veränderung darin sieht: Veränderung darf nicht Rückschritt sein, das wäre eine Katastrophe, sondern muss stets und immer vorwärts und besser werdend sein. Es gibt allerdings andere Wege, wie man sich das Zeitgefüge visualisieren kann: als Welle, als Kreis oder auch als kristallartiger Baum, der sicch immer weiter verzweigt. Wenn Schulrn es gelingt, den Sxhülern die geistige Möglichkeit zu geben, mit den Vorstellungen von Zeit und Wandel flexibel umzugehen, gelingt es damit auch, die Veränderungen und die vielen verschiedenen Möglichkeiten von Zukunft als Chancen zu begreifen.
Think creativly about the curriculum
Die Fächwr müssen von der vergangenen Orientierung in eine zukünftige gebracht werden. In der Vergangenheit war es wichtig, Wissen in Fächer einzuteilen, da die Menge an Wissen seit der Einführung des Buchdruckes zu divers wurde, um „alles“ zu erfassen. Heutzutage führt diese Idee der Spezialisierung aber zu einer immer stärker werdenden Isolierung und Überforderung, da der Pool der verfügbaren Informationen so immens groß geworden ist. Statt Fachwissen benötigt man daher eher Fachkompetenzen, skills, um das jeweils fachspezifische Wissen zum richtigen Zeitpunkt selbstständig internalisieren zu können. (Mathematisches Wissen ist anders zu erfassen als beispielsweise literarisches Wissen, aber man braucht keine Unterscheidung in Mathe: Algebra und Mathe: Analysis, da hier ähnliche geistige Prozeduren zum Erfassen der Inhalte nötig sind.) Das Curriculum muss den Schülern also 4 Kompetenzen in den Fachausrichtungen vermitteln:
- modelling (Die Realität/einen Zusammenhang erfassen und modellhaft darstellen)
- stewardship (Das Wissen ordnen und verwalten, Vielfalt erfassen)
- reflexibility (reflexiv und kritisch Wissen und Handeln prüfen)
- experimentation (kreativ mit dem Wissen handeln, erfinden und so neues Wissen generieren)
learn to live with our emotions
Angst vor einer möglichen Zukunft oder das Klammern und unbedingte Erreichen einer bestimmten Utopie sollten nicht unser gegenwärtiges Handeln bestimmen. Stattdessen ist es wichtig, den Schülerinnen und Schüler grundlegende Werte zu vermitteln: Liebe, Freundschaft, Gemeinschaft, Fürsorge und Unterstützung. Auch Zuversicht in die Zukunft, die sowohl unangenehme als auch angenehme Bestandteile haben kann, ist wichtig. Statt als Lehrer zu denken, dass man sozial schwache Schüler aus „ihren schädlichen Umgebungen retten muss“, sollte man beginnen, zu denken, dass man sie unterstützen muss, sich und den anderen eine bessere Gemeinschaft aufzubauen – und ihnen das auch zutrauen. Dabei ist zu beachten, dass man nicht die Verantwortung ganz an die Kinder abgibt, sondern einen respektvollen Dialog mit ihnen aufbaut. In einer Umgebung, in der Emotionen und Ungewissheit wahrgenommen werden, aber nicht blind das Handeln bestimmen und in der gemeinschaftliche Grundwerte prägend sind, kann eine sinnvolle Zukunft entstehen.
Abschließend erinnert sie uns noch einmal daran, dass es nicht eine einzige Zukunft ist, auf die wir unsere Schüler und Schülerinnen vorbereiten, und dass Bildung mit der gesamten Gesellschaft verbunden sein muss, um die gesamte Gesellschaft zu verändern. Alleine kann Schule wenig bewegen.
Zum Ende des Tages hat das Publikum die Möglichkeit, Fragen an sie zu stellen, was rege genutzt wird, um Gedanken und Probleme aus verschiedenen Lebenlagen und Projekten einzubringen. Ich erinnere mich besonders an einen Schüler, der fragte, wie man denn all diese Veränderungenm bevor man sie überall implementiert, erstmal an die eigene Schule bringen kann. (Keris Antwort erinnere ich nicht mehr genau, ich glaube, es war etwas wie „buildt partnerships and start dialogs, be stubborn“) Jemand aus dem medienpädogogischen Bereich warf ein, dass es oft problematisch sei, Lehrer selbst zum lernen zu bringen, worauf ich ergänzte, dass Lehrer oft in zeit- und ressourcenknappen Umgebungen arbeiten, die emotional anstrengend sind, wenn man sich nicht komplett verschließt. Wir benötigen daher die Hilfe aller Akteure, um uns die Freiräume zu schaffen, die für Weiterbildung und Entwicklung notwendig sind. Nach der Diskussion und auch am nächsten Tag haben mich viele angesprochen und sich für meinen Beitrag bedankt, das war also offensichtlich ein relevanter Punkt nicht nur für mich.
Der Tag endete für mich mit einer anregenden Diskussion mit meinem Gastgeber, der mir über die Mailingsliste des CCC einen Schlafplatz angeboten hat. (Vielen Dank dafür!)
5.5.2017
Mein zweiter Tag auf der Konferenz „Schools of tomorrow“ beginnt recht spät, da ich die ersten Workshops nicht besuchen kann – alles ist voll.
Also höre ich als erstes den Vortrag von Mizuko Ito: „learning in digital enviroments“.
Für Menschen, die mit dem Internet aufwachsen, ist klar, dass das Internet mit seinen Videos und Tutorials ein Ort des Lernens ist. Beim Lernen geht es zumeist um Interesse, und das Internet birgt eine Menge an Daten zu nahezu jedem Interesse an. Es entsteht also eine kulturelle Kluft zwischen dem institutionalen und dem Internet-basierten, oft informellen Lernen. Ein großer Teil der (amerikanischen) Menschheit verbringt viel Zeit online, die meisten spielen dort auch und gründen neue Freundschaften, die in 20% der Fälle auch in das nicht-virtuelle Leben transferiert werden. Gleichzeitig haben die Institutionen das Problem, dass das Engagement zum Lernen im Laufe der Schulkarriere immer weiter sinkt. Es gab sogar mal eine Studie, die nachwies, dass 45% aller Schüler keinen messbaren Lernzuwachs in den ersten beiden Jahren des Colleges haben. Schüler zum Lernen zu motivieren, war immer schon ein Problem der Lehrer, aber die rasante Entwicklung der Welt (sowohl medial als auch durch die Schere zwischen arm und reich, die auch den Zugang zu Bildung beeinflusst) öffnet die Kluft zwischen der realen Welt und der Schule immer weiter.
Viele Pädagogen und Erziehunsgwissenschaftler hoffen, dass mit dem frei verfügbaren Wissen der Netzes die Zugangsschwierigkeiten überwunden werden können. Aber es zeigt sich leider, dass Menschen mit einem höheren Bildungshintergrund die freien Ressourcen mehr zu ihrem Nutzen einsetzen können. So schließt sich die Lücke zwischen Reich-Gebildet und Arm-ungebildet nicht, sondern öffnet sich immer weiter.
Eine Theorie, die an diesem Punkt ansetzt, ist die Theorie des „connected learning“. Sie geht davon aus, dass Lernen oft außerhalb der Schule an Interessenpunkten beginnt. Um es in ein für die akademische Laufbahn nutzbares Lernen umzusetzen, benötigt es die Verbindung von Interesse, Peers und der Möglichkeit, dieses Lernen in die Schule zu tragen. Illustriert wurde dies im Vortrag am Beispiel eines Mädchens, die gerne Minecraft spielte (Interesse), mit ihren Freunden einen Club in der Schule gründete und begann, Videos zu drehen (Peers, die das Interesse verstärken und weiter führen). Durch die Unterstützung der Schule war es nicht nur möglich, die Gelegenheit für die Videos zu schaffen, sondern es entstanden so gute Produkte, dass die Schulzeitung Interesse zeigte und die Schülerin begann, dort Artikel zu schreiben (oder es wurde über sie geschrieben, da war mein Englisch nicht genau genug.) So gelangte das Interesse letztendlich in einen Lernprozess über Handlung und Plot interessanter Videos, Pressearbeit und ähnlichem. Zusätzlich bekam das Mädchen Anerkennung und erlebte sich selbst im schulischen Kontext als kompetent und wirksam.
Viele Akteure im Bildungsbereich sind fokussiert auf die „pipeline“: Von Kita bis Hochschule wird alles immer linear durchdacht. Es ist aber wichtig, die informellen Lernwege, beispielsweise auch informelle Mentoren, mitzudenken und sich zu bemühen, ihre positiven Effekte mit der Hauptlinie der akademischen Entwicklung zu verbinden, um sie nutzbar zu machen.
Natürlich gibt es auch Stoffinhalte, die man ohne Interesse daran lernen muss, und manchmal werden Lernprozesse nicht verknüpfbar sein. Das ist ok – im Generellen sollte man die Idee der Verbindungen aber im Kopf behalten. Projekte, die dies tun, sind beispielsweise „YouMedia learning labs „(Chicago) oder „connected camps“, bei denen Jugendliche gemeinsam online lernen können. (Obwohl die Idee des connected learning zunächst immer unabhängig von digitalen Möglichkeiten gedacht werden kann, bringt die Technik oft neue Spielräume, die ein Lernen mit Peers und in Verbindung zur Schule erleichtern.)
Als zweites wird die Schule „Quest to learn“ vorgestellt, in der Spieledesigner, Erziehungswissenschaftler und Lehrer zusammenarbeiten, um in den Unterricht möglichst viele Quests und Lernspiele zu integrieren, mit denen man Level aufsteigt und so seinen Schulerfolg meistert. Die „Quests“ sind dabei komplexe Aufgabenstellungen, die verschiedene Lernprozesse anregen und motivieren. Es werden verschiedene Beispiele aus dem Unterricht genannt (aber da musste ich grad mal telefonieren, wie schade). Die Materialien sind teilweise unter cc-Lizenz auf der homepage verfügbar: www.instituteofplay.org
Den letzten Vortrag hat Benjamin Jörissen, der auf deutsch über Netzwerktheorien in Bildung spricht. (Das ist meine Muttersprache, ja, aber ich verstehe trotzdem weniger als bei den anderen Vorträgen. Soziale Theorien sind immer so abstrakt und er spricht sehr schnell.)
Auch er geht zunächst auf die Veränderung der Gesellschaft durch Digitalisierung ein und betont dabei besonders die Bedeutung, die Algorithmen gewinnen: Wir sind plötzlich anderen, nicht-menschlichen Logiken ausgesetzt, die unsere Netzwerke mitprägen. Dabei ist zu beachten, dass es sich bei dem digitalen dennoch (nur) um eine – oft unsichtbare – Infrastruktur handelt. Er vergleicht es mit einem Pilz: Wir sehen den Kopf (zum Beispiel die Plattform facebook), aber der Hauptteil des Pilzes liegt unter der Erde (die zugrundeliegenden Techniken und Algorithmen, vom Funktionieren des PCs bis hin zum Filteralgorithmus) und wird nicht wahrgenommen oder zumindest nicht verstanden.
Digitalisierung taucht in Bildungskontexten oft in zwei Diskussionsaspekten auf: Zum Ersteb ist es in Form von Tools und Plattformen eine Ressource, die Lernen und Lehren verändert. Zum Zweiten ist es, bezogen auf die Idee des Pilz-Myzels, ein „Graben in der Erde“: Man redet und reflektiert über die digitale Technik, entwickelt kritische Medienkompetenz und betrachtet die Digitalisierung an sich damit als pädagogischen Gegenstand. Jörissen weist darauf hin, dass die Diskurse eine dritte Dimension beachten müssen: Digitalisierung ist auch ein kultureller Prozess, eine Transformation von Lebenswelt.
Es gibt viele Studien zu Netzwerken und seit den 70er Jahren ist dabei schon bekannt, dass die schwachen Verbindungen in Netzwerken besonders wichtig für die Struktur und die Wirkweisen wie beispielsweise Filtereffekte dieser Netzwerke sind. Besonders spannend ist dabei der Raum zwischen den einzelnen Netzwerken: In dieses „structural holes“ ist es möglich, neues zu lernen. Man lernt beim Suchen von Verknüpfungen von Netzwerken, deren Verknüpfungen man zuvor nicht kannte „things you didn‘t know you didn‘t know“. Die Erschaffung von Identität und Kreativität findet daher besonders im Raum zwischen verschiedenen Netzwerken statt. („Ich gehöre hier und da hin, ich bin ein Verbindungsglied von hier und da. Ich kenne verschiedene Logiken/ Semantiken/ Verhaltensweisen für meine verschiedenen Netzwerke und kann sie situationsgerecht anwenden, das schafft eine Diversität im Inneren, die erst mich als Individuum ermöglicht.“) Dies ermöglicht eine neue Art des Lernens und der Pädagogik, bei der Netzwerke gefördert werden.
Dabei ist Netzwerk-Kritik eine notwendige Bedingung „digitaler Souveränität“ und wirft zahlreiche Fragen auf. Wer bestimmt, wie das digitale Sozialisieren funktioniert? (Wir oder Algorithmen oder beide?) Wer hat welche Macht? Netzwerken passiert unbewusst und bewust. Wir wissen beispielweise nicht, wie genau „kennen lernen“ funktioniert, können aber bewusst entscheiden, einem Kontakt mehr oder weniger zeit zu widmen. Jörissen fordert – und ich stimme da vollständig zu – dass wir nicht nur in den Netzwerken bewusst mitreden können sollten, sondern auch über die Netzwerke, also über den Code und die Software, die ja aber oft noch unsichtbar sind. Man muss aber die Logik von sozialen und digitalen Netzwerken verstehen, um Souveränität zu erlangen.
Auch diese Talks schließen mit einer Diskussionsrunde. Im Anschluss besuche ich den Workshop „Digitale Selbstermächtigung“, dessen Arbeitsergebnisse am Abend auf der Bühne präsentiert werden. Meine Mitschrift in Form einer MindMap findet sich hier.
Bezeichnend ist mir folgendes Gespräch in den Arbeitsgruppen in Erinnerung geblieben: Wir sprachen über die Gefahren des „gläsernen Bürgers“, über die Notwendigkeit des Datenschutz und wie sehr Firmen unsere Daten auch im Bildungssektor abgreifen. Ein älterer Kollege beugte sich vor und sagte: „Wir reden darüber und sind uns alle auch so in etwa einig. Aber mich interessiert jetzt mal, was die junge Generation dazu sagt.“ Er wandte sich an zwei anwesende Schüler: „Was sagt ihr dazu? Habt ihr Angst? Was denkt ihr, wenn ihr all diese Tools benutzt, die die Daten sammeln?“ Beide Schüler denken kurz nach, dann antwortet der eine: „Ich versteh nicht, warum ihr euch da so Angst macht. Es ist einfach praktisch.“ Der zweite ergänzte: „Ich hab auch keine Sorge oder so. Dieses Datensammeln und so, das passiert ja im Hintergrund, das kriegt man gar nicht mit, und die ganzen Dienste, die erleichtern halt echt das Leben. Und da gibt es ja auch noch rechtliche Vorgaben, damit die Konzerne uns jetzt nicht so doll ausnutzen oder so.“ Die Aussage stimmt mich – auch Tage danach – nachdenklich. Die beiden haben Recht. Die datensammelnden Apps machen das Leben leichter. Nicht nur den Konzernen nutzt BigData – auch uns, ganz direkt. Aber die verborgene Gefahr des Missbrauchs, des Ausspähens und Manipulierens bewusst zu machen, ist dennoch wichtig. Nur wie? Die Gesprächsrunde zuvor hat bei den Jugendlichen nichts bewirkt. Ist es überhaupt sinnvoll, eine ganze Generation mit Angst zu „impfen“? Oder ist das gesundes, kritisches Hinterfragen, das den beiden fehlte? Immerhin waren sie freiwillig zu einer solchen Konferenz gefahren, um sich zu beteiligen, zu lernen und ihre Stimme für die Zukunft einzusetzen. Was ist notwendig an Misstrauen und was ist nur die Panikmache einer älteren Bevölkerung, für die die Veränderung der gesellschaftlichen Strukturen unheimlich ist?
Der Abend schließt mit zwei netten Gesprächsrunde, eine mit einigen Mitstreitern der Workshops und eine mit meinem Gastgeber.
6.5.2017
An meinem dritten Tag in Berlin merke ich langsam, dass es ziemlich anstrengend ist, auf Reisen zu sein und so viel neues zu hören. Der Morgen vergeht mit Sachen-packen und Frühstücken.
Ich bin erst gegen Mittag mit all meinem Reisekram im Haus der Kulturen der Welt und höre mir den Vortrag von Gert Biesta an: „The beautiful risk of education“
Er erinnert daran, dass die Veränderung von Schule auch bedeutet, die Verbindung von Schule und Gesellschaft zu verändern und wendet sich in seinem Vortrag der Rolle der Lehrer zu. Dabei weißt er zunächst auf die sprachliche Hürde hin, das Wort „educator“nins Deutsch zu übertragen. Nur in der deutschen Sprache unterscheidet man zwischen „Bildung“ und „Erziehung“. Biesta möchte das Wort eher im Sinne des „Erziehers“ übersetzt haben, aber natürlich schwingt in seiner Rede immer mit, dass dieser Erzieher im Englischen auch als der Vermittler von Bildung gemeint ist.
Die Frage, die er stellt, lautet: Was müssen die Erzieher tun, um Schule und Gesellschaft zu verändern?
Dabei ist zunächst zu klären, welche Art von Gesellschaft sich derzeit entwickelt. Migration und Digitalisierung stellen sicherlich große Schwierigkeiten dar, aber die Kernmentalität ist problematischer: „It‘s shopping time.“ (Gelächter im Saal)
Etwas zu „shoppen“ bedeutet, ein Begehren (Biesta nutzt das Wort „desire“) zu erfüllen – rasch und meist ohne weitreichende Konsequenzen zu bedenken. Wir begehren – wir erfüllen das Begehren so leicht wie möglich. Dabei ist „bekommen, was man will“ nicht immer ein guter Weg. Die Konsummentalität und der Kapitalismus beeinflussen aber unser Denken, so dass die Erfüllung von Wünschen als etwas immer gutes erscheint. Die Folge ist eine impulsive Gesellschaft, die die dazu spezifische Probleme hat:
- Um stets positiv zu steigern, muss die Wirtschaft immer weiter wachsen und wachsen. Dies ist aber limitiert. Da das Erschließen lokal neuer Märkte sehr begrenzt ist, haben die Firmen begonnen, unsere Gedanken als Markt zu erschließen. Beispielsweise verkauft Apple längst nicht mehr nur ein gutes Telefon: Sie verkaufen vielmehr das Bedürfnis, ein neues Smartphone zu besitzen. Auch andere Wirtschaftszweige erzeugen via Werbung, Produktmarketing und ähnlichem immer neue Bedürfnisse, um diese weiter befriedigen zu können und so weiter zu wachsen.
- Politiker springen auf den Zug auf: Sie versprechen, all das zu tun, was die Wähler wollen, können ihre Versprechen aufgrund von Ressourcen oder Widersprüchen in den Wünschen aber nicht halten und erzeugen so Frustration.
- Die gesamte Demokratie gerät durch die Begehrensorientierung ist Gefahr: Bedürfnisse des Egos zu erfüllen, gehört zur Identitätsbildung und Separierung von der Gesellschaft. Der Wunsch nach einer puren, absolut eigenen Identität aber zerstört die Idee von Gemeinschaft in sich – wichtig ist eigentlich eine ausgewogene Balance. (Ah, Herr Professor Grundmann, Einführung in die Deutschdidaktik, wie sehr es doch immer wieder zu tragen kommt, diese Idee von Entfaltung und dem Zusammenspiel von Individuum und Gesellschaft. Hat sich die Uni also doch gelohnt.)
- In der Gesamtheit ist also auch unser Planet in Gefahr – er ist einen imitierte Ressource, die wir für unsere unbegrenzten Bedürfnisse nutzen wollen, das kann nicht funktionieren.
Auch die Schule fällt immer mehr dieser „Shopping-Mentalität“ anheim. Lehrer sollen Schülern geben, was diese wollen – Antworten, Kompetenzen, Abschlüsse. Stattdessen wäre es notwendig, den Schülern Fragen zu stellen, denen sie sich nicht aus eigenem Antrieb stellen wollen. Doch das Maß der Zufriedenheit der Schüler wird als Maß für den Erfolg der Lehrer genutzt – besonders in der digitalen Welt. Dabei fehlt ein Realitätscheck. Das Ego bzw. das Begehren in das Zentrum der eigenen Welt zu stellen ist kindlich. Biesta verweist noch einmal extra darauf, dass er nicht sagen möchte, Kindlichkeit sei etwas generell schlechtes, doch erinnert daran, dass wir uns erwachsen verhalten müssen, um uns und unseren Planeten weiter zu entwickeln. Nicht ich bin das Zentrum der Welt, die Welt ist es.
Um in einer erwachsenen Art (grown-up-way) unsere Leben gestalten zu können, müssen wird unsere Wünsche in einen Dialog mit der Welt, und zwar sowohl mit der sozialen als auch der natürlichen, also der Realität außerhalb von uns selber, setzen – „being in the world without being in the center of the world“ (Meriue 2000 nach Biests). Das können viele Erwachsene übrigens auch nicht, und es ist eine lebenslange Aufgabe, in jeder Situation immer wieder neu in diesen Diakog zwischen Ego und Welt zu tretebm besonders für Lehrer, die eine Vorbildfunktion haben. Die Aufgabe der Lehrer und Erzieher ist es dann, den Wunsch nach dieser erwachsenen Lebensweise in den Jugendlichen zu wecken, denn ein autoritäres Vorgehen wäre sicher nicht von Erfolg gekrönt. Zudem wäre es nicht möglich, Vorgaben zu vermitteln,welche Begierden sinnvoll sind und welche nicht. („which desires are desireable“) Die Menschen brauchen stattdessen selbst die Fähigkeit, neues Begehren immer neu in diesem Dialog einschätzen zu können, um mündig an einer erwachsenen Lebenswelt teilnehmen und diese sinnvoll bewahrend mitgestalten zu können.
Wie weckt man den Wunsch nach einer erwachsenen Lebensweise? Am effektivsten ist es, die Schüler die Realität und den Widerstand erleben zu lassen. Die darauf folgende Frustration kann zu Reaktionen zwischen zwei extremen Polen führen: Mit mehr Kraft stärker versuchen, eventuell bis hin zur Gewaltanwendung (dies birgt die Gefahr der Zerstörung der äußeren Welt) oder Rückzug, Aufgabe (dies birgt die Gefahr der Selbstzerstörung). Im Mittelfeld zwischen diesen beiden Polen findet Erziehung und Lehren statt, in dem die Notwendigkeit des Dialoges zwischen innen und außen vermittelt wird. Die erzieherische Arbeit hat dabei therapeutische Züge, ohne dass man „kindisch sein“ je als Krankheit auffassen sollte. Im lebenslangen Lernen und im ständigen Dialog gibt es keine Gewinner oder Verlierer, nur das Gespräch und den Austausch an sich.
Notwendige Fragen sind daher: Ist das wünschenswert für mich, für mein Leben mit Anderen, für den Planet? Manchmal muss ein Begehren, ein Wunsch dann neu sortiert oder transformiert werden, durch den Erzieher, so dass er den erwachsenen Lebensweg unterstützt und zu ihm passt. Dies kann ein Jugendlicher nicht unbedingt allein, die Transformation des Begehrens braucht Anleitung. (That’s education!)
Die Arbeit des Erziehers beinhaltet dabei:
- Interruption: Das reine Bedürfnis an (reiner) Identität stören, die Konzentration auf das Ego unterbrechen und den Schüler wieder auf die Welt ausrichten
- Suspension: Raum schaffen für Dialog zwischen den Bedüfnissen und zum Üben/Austesten von Verhaltensstrategien und Handlungsmöglichkeiten, zum Üben von Erwachsen-Sein (das ist ein langwieriger, langsamer Prozess)
- Sustenance: Unterstützung gewährleisten, damit der Schüler/Jugendliche im Mittelfeld zwischen den extremen Polen bleiben kann. Bewusst machen, dass Schwierigkeiten im kurzzeitigen zu ertragen oftmals langfristige Vorteile bringt.
Die Curricula erfüllen dabei die wichtige Funktion, Situationen und Inhalte bereit zu halten, der Realität zu begegnen, und zwar auf verschiedene Art und Weisen je nach Fach. Die Schule der Zukunft soll also insbesondere ein Art sein, um Erwachsen-Sein zu üben (try, fail, try again, fail better), denn das reine Lernen kann oft andersowo besser und schneller geschehen (etwa online).
Was hat das mit Demokratie zu tun? Demokratie gibt uns Freiheit, die wir auf eine erwachsene Art nutzen müssen. Dazu ist es notwendig, nicht eine „Tyrannei der Mehrheit“ als Demokratie zu verstehen, in der einfach Bedürfnisse gegeneinander abgezählt werden, sondern ein Prozess, in dem die verschiedenen Bedürfnisse zu gemeinsamen, kollektiven Bedürfnissen geordnet und transformiert werden, basierend auf unseren liberalen Werten wie Freiheit, Solidarität ect. (Wobei natürlich auch die Werte kritisch hinterfragt werden dürfen und sollten.)
Erziehung sollte also weder schüler-orientiert noch curriculum-orientiert, sondern welt-orientiert sein, so dass die Jugendlichen in ihrem Rahmen üben können, in der Welt zu sein, ohne ihre egoistischen Bedürfnisse in den Mittelpunkt zu stellen. (Oder: stellen zu müssen.)
Im anschließenden Talk bemerkt eine Sprecherin: „Being grown-up is so unsexy!“ (Gelächter im Saal). Biesta stimmt zu und erinnert daran, dass es gerade deswegen wichtig ist, den Wunsch nach einem Leben in dieser erwachsenen Welt zu erwecken, indem man vermittelt, dass es alles wert ist, langfristig und gemeinsam zu leben, weil es eben mehr gibt als nur das Ego.
Ich verlasse den Saal ziemlich übervoll mit Gedanken und verbringe den Rest des Nachmittags mit meinen Gedanken und Notizen. In die Abschlussveranstaltung kann ich leider nur kurz reinschnuppern, mein Zug fährt um kurz vor 10. Um Mitternacht bin ich geschafft und zufrieden wieder in Hamburg. Es waren drei wundervolle, inspiriende Tage, die mich noch viele Stunden weiter beschäftigen und motivieren werden. Ich danke allen, die dies möglich gemacht haben und allen, die weiterhin ihre Energie dazu nutzen, gemeinsam unsere Zukunft zu verbessern.

Schools of Tomorrow – Reisebericht von MBraun ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International Lizenz.